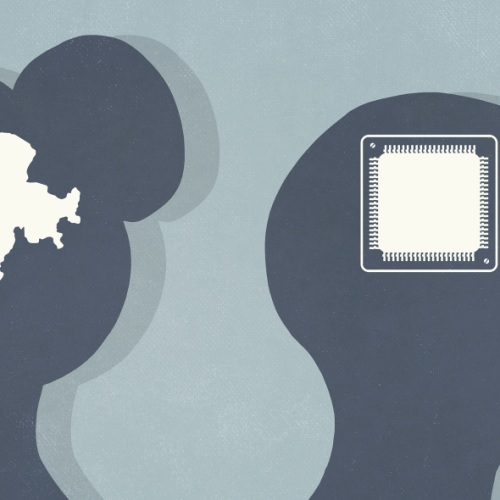«Tatort» Operationssaal
Recycling liegt uns Schweizern schon fast im Blut: Mehr als die Hälfte aller Haushalts- und Gewerbeabfälle werden hierzulande wiederverwertet. Grosse Firmen verfügen heute fast alle über eigene Nachhaltigkeitsprozesse und -richtlinien. Doch wie sieht es im Gesundheitswesen aus? Mit sieben Prozent Anteil an den gesamten CO2-Emissionen in der Schweiz belegt der Gesundheitsbereich den 4. Platz. Eine Studie aus Deutschland ergab, dass 20 bis 30 Prozent des Abfalls aus Spitälern in den Operationssälen generiert und 50 bis 90 Prozent des als infektiös eingestuften Mülls falsch einsortiert wird. Zahlen, die drastisch sind in einer Zeit, in der Nachhaltigkeit immer wichtiger für unsere Gesellschaft wird.
Zuerst sortieren, dann recyclen
Von Abdeckungsmaterial über Verbände, Gazen, Operations-Kits, Infusionen, Schläuche bis zu Karton, Papier und Bioabfall; in einem OP werden täglich grosse Mengen an unterschiedlichen Produkten und Materialien verwendet. Auch wenn sich einiges sammeln und wiederverwerten lässt, muss doch ein grosser Teil separat entsorgt werden und wird so nicht in den Recyclingprozess aufgenommen. Dazu gehören die vielen steril verpackten Einwegprodukte. «In dieser hygienisch hochsensiblen Arbeitsumgebung sind wir gesetzlich verpflichtet, kontaminierte Produkte speziell zu entsorgen», sagt Sabrina de la Vigne, Präsidentin vom Verein für Kunststoffentsorgung im Spital KEIS. «Hinzu kommt, dass viele medizinische Produkte aus Kunststoff angefertigt sind, der wiederum aus einem Kunststoffgemisch besteht und deshalb nicht einfach rezykliert werden kann.»

In dieser hygienisch hochsensiblen Arbeitsumgebung sind wir gesetzlich verpflichtet, kontaminierte Produkte speziell zu entsorgen
Zeitdruck und wenig Platz in den OPs
Die Frage, wie Nachhaltigkeit in den Operationssälen verbessert werden kann, beschäftigt unter anderen die Hirslanden AG, der schweizweit 17 Spitalbetriebe angehören. Claudia Hollenstein ist Head of Sustainability and Health Affairs bei der Hirslanden-Gruppe und kennt die Entsorgungs- und Recyclingproblematik in den OPs. Ein wichtiger Punkt, der für sie dazukommt, ist der enorme Zeitdruck in den Operationssälen. «Hier ist alles auf die Minute durchgetaktet, da bleibt zwischen den Operationen wenig Zeit für Abfalltrennung und Recycling», so Hollenstein. Auch bieten die hochtechnologisch ausgestatteten Räume nur beschränkt Platz für Sammelstellen und -behälter.
Nachhaltigkeit und Patientensicherheit Hand in Hand
Dennoch, der Anspruch, medizinisches Material in den Werkstoffkreislauf zurückzuführen, ist da. Gleichzeitig hat die Patientensicherheit im OP-Bereich oberste Priorität. Beide Ansprüche miteinander zu vereinen, ist eine Herausforderung. Aber es gibt Lösungsansätze, die schon jetzt Anwendung finden. «Recycling beginnt nicht erst im Operationssaal, sondern schon bei der Herstellung der OP-Produkte», ist Sabrina de la Vigne überzeugt. «Heute werden Geräte so konzipiert, dass sie in den Recycling-Prozess zurückgeführt werden könnten. Das ist ein grosser Fortschritt gegenüber früher», ergänzt Claudia Hollenstein.
Geteilte Verantwortung
Hersteller haben erkannt, dass sie einen bedeutenden Einfluss auf den gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte haben. Daher liefern sie spezielle Behälter an die Spitäler, in denen die Produkte gesammelt und nach Gebrauch zurückgegeben werden. Durch das sorgfältige Extrahieren der einzelnen Materialien können diese fachgerecht entsorgt und kostbare Rohstoffe wie Stahl, Titan, Aluminium und Chromstahl auch nach der einmaligen Verwendung wieder nutzbar gemacht werden. Bereits vor rund zwei Jahren hat Johnson & Johnson in der Schweiz mit der Lindenhofgruppe ein entsprechendes Projekt erstmalig lanciert. Allein in der sechs Monate dauernden Pilot-Phase wurden rund 220 Kilogramm Plastik und 90 Kilogramm wertvolle Metalle gesammelt – und damit knapp eine Tonne CO2 gespart. Oder konkreter: Bei jeder Wiederverwertung eines Einweginstrumentes wird so viel CO2 eingespart, wie ein Auto bei einer 10km langen Fahrt ausstösst.

Ohne die Partizipation der Mitarbeitenden geht es nicht, deshalb ist es wichtig, sie in diesen Prozess miteinzubeziehen und zu motivieren.
Mitarbeitende in den Prozess miteinbeziehen
In der Zwischenzeit arbeiten 13 Spitäler und Kliniken mit Johnson & Johnson im Rahmen dieser Initiative zusammen, wie etwa Mitglieder der Hirslanden- und Swiss Medical Network- Gruppe. Und mittlerweile hat Johnson & Johnson weitere Lösungen entwickelt, etwa für Aluminium- und PETG-Packungen, und in 31 Schweizer Spitälern implementiert.
Worin die Spitäler weiter investieren müssen, ist die sachgerechte Trennung der gebrauchten Produkte und Materialen bereits in den Operationssälen. «Dazu müssen die Mitarbeitenden geschult werden», sagt Claudia Hollenstein: «Ohne die Partizipation der Mitarbeitenden geht es nicht, deshalb ist es wichtig, sie in diesen Prozess miteinzubeziehen und zu motivieren.»
Gemeinsam ans Ziel
Experten gehen davon aus, dass ein Krankenhaus, das jährlich 10'000 medizinische Produkte verwendet, durch effektives Recycling im Durchschnitt etwa 2’600 Tonnen CO2 einsparen kann. Um diese Menge zu erzeugen, müsste ein mittelgrosses Auto fast die halbe Welt umrunden. Die Weichen für den nachhaltigen Operationssaal sind gestellt. Jetzt geht es darum, den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen. Die Zukunft des Recyclings im Gesundheitswesen hängt von der engen Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern, Herstellern, Lieferanten und Behörden ab. Mit kontinuierlichen Bemühungen und Innovationen kann das Schweizer Gesundheitswesen seinen Beitrag zur Reduzierung von Abfall und CO2-Emissionen leisten, und gleichzeitig die Gesundheit und Sicherheit der Patienten und die Umwelt schützen.