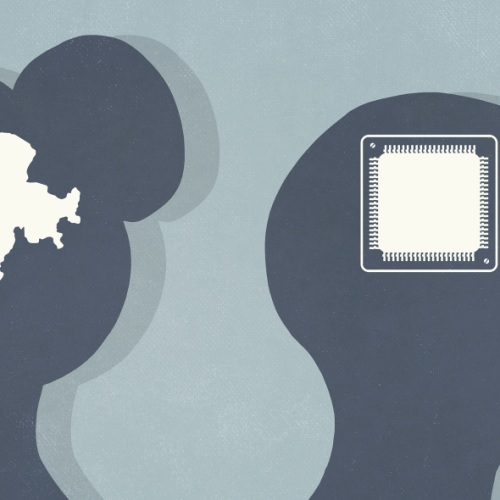«Wie geht es dir?» – Im Alltag begegnen wir dieser Frage ständig und erhalten kurze oder ausführliche Antworten. Wir wissen: Die Frage erlaubt Tiefgang, ermöglicht es, dass wir über unsere Gefühlte sprechen, und ist doch eine Floskel.
Pro Mente Sana, eine Schweizerische Stiftung für psychische Gesundheit, wollte wissen, wie es den Menschen in der Schweiz wirklich geht und beauftrage die Forschungsstelle Sotomo mit einer repräsentativen Umfrage. Im September 2018 wurden über 5’500 Menschen in der Schweiz zu ihrem psychischen Wohlbefinden befragt.
Fakt ist: Auf die Frage «Wie geht es dir?» antworten die meisten der Befragten mit «Gut» oder «Sehr gut», obschon das teils gar nicht zutrifft. Die gute Laune trügt. Erst auf konkretes Nachfragen gab beinahe ein Fünftel der Befragten an, sich gegenwärtig in einem länger dauernden psychischen Tief zu befinden. Und fast zwei Drittel bestätigten, dass sie bereits Lebensphasen hatten, in welchen es ihnen nicht gut ging. Die Frage drängt sich auf: Welche versteckten Emotionen verbergen die lächelnden Gesichter?
Den Mutigen gehört die Welt
Emotionen zu thematisieren, fällt vielen schwer. Oft ist es unangenehm und man hat Angst vor den negativen Reaktionen, davor, dass man ein stigmatisiertes Label aufgedrückt bekommt und beispielsweise als Schwächling abgestempelt wird.

Es braucht Mut, um offen über die Gefühle zu sprechen.
Über Gefühle zu sprechen, heisst, dass man sich um die eigene Psyche sorgt. Allgemein erlebt jede zehnte Person in der Schweiz mittlere bis hohe psychische Belastungen – von Stress, Angstzuständen, Panik-Attacken, Depressionen bis hin zu Burnout. Noch heute sind psychische Erkrankungen grösstenteils ein Tabu in unserer Gesellschaft. Es wird nicht mit einer Offenheit oder Selbstverständlichkeit darüber gesprochen. Und doch tut sich was.

Die jüngeren Generationen schaffen hoffentlich den Wandel, dass Menschen, die eine Auszeit nehmen, nicht als Schwächlinge gelten.
Gerade jüngere Personen zeigen sich verletzlich und sprechen über die Psyche und ihre psychische Gesundheit. Sie verkleinern das gesellschaftliche Tabu. So steigt auch die Bereitschaft, sich helfen zu lassen und eine Therapie zu besuchen.

Wir haben eher gelernt über Gefühlen zu sprechen, damit umzugehen, und machen damit gute Erfahrungen.
Menschen sollen Fehler machen, gerade am Arbeitsplatz
Fest steht: Nicht nur die Jungen sprechen offener über Gefühle, auch in Unternehmen gewinnt die Psyche an Bedeutung. Viele Arbeitgeber lancieren Mental-Health-Programme oder Achtsamkeits- und Yoga-Klassen. Denn der Leistungsdruck nimmt zu, ein gesunder Umgang damit ist für Unternehmen und die Gesellschaft unabdingbar.

Wir fokussieren auf persönliche Bedürfnisse und ermöglichen Zugang zu professioneller Hilfe.
Wichtig ist eine Unternehmenskultur, bei der Fehler gemacht werden können und in welcher über die Gefühlslage gesprochen wird und Hilfe zur Verfügung steht. In einer solchen Umgebung ist man in einem geschützten Raum; da macht die Arbeit Freude, was sich positiv auf die psychische Gesundheit und das Arbeitsklima auswirkt.
Ein Grundrezept für die psychische Gesundheit gibt es nicht. Doch wir alle können mehr zuhören, Empathie zeigen, uns um unsere Mitmenschen kümmern. Und dann Hilfe anbieten, wenn sie notwendig ist.